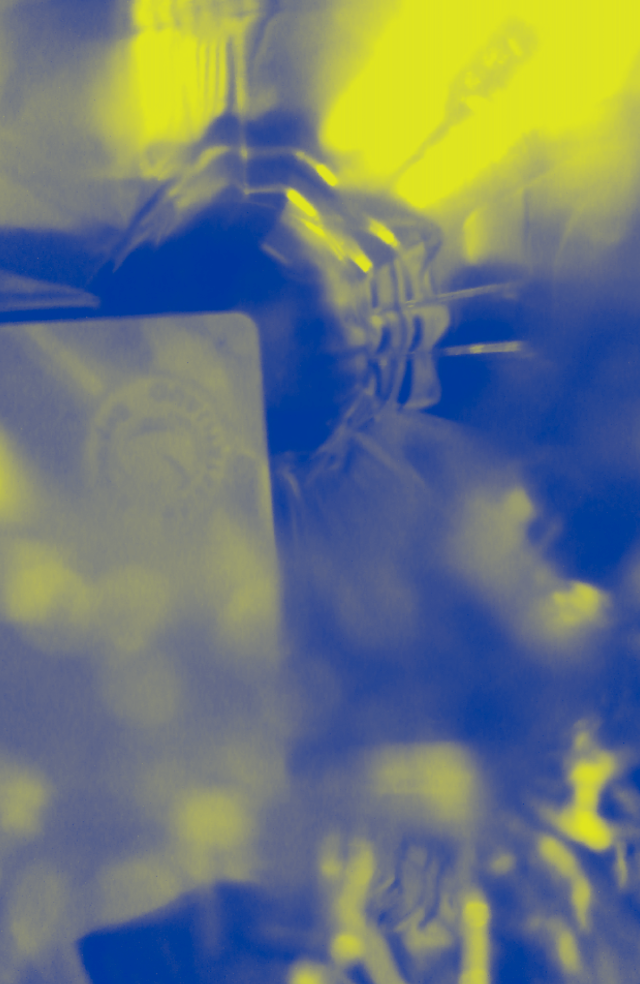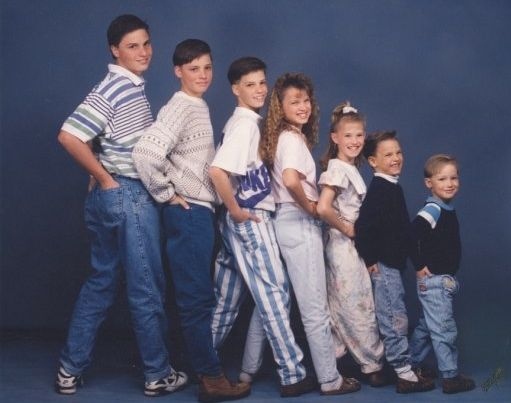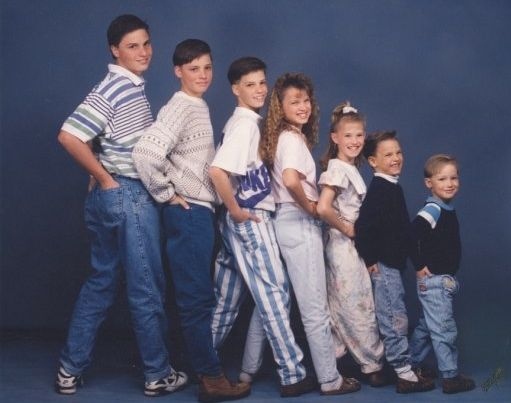
Die Betrachtung von Arbeitslosigkeit, sozialer Exklusion oder Prekarität kann nicht bei der empirischen Frage nach den Lebensbedingungen der betroffenen Gruppen stehen bleiben, denn als soziologisch gefasste Identitäten sind sie lediglich Erscheinungsformen oder Momente der Totalität von Kapital und Arbeit. Die gegenwärtige Reproduktion dieses Verhältnisses vollzieht sich dabei in der Entwertung der Ware Arbeitskraft durch die Kategorie des Surplus-Proletariats.
Einleitung
Auch im Jahr 2015 werden Hoffnungen auf eine Erholung der Arbeitsmärkte fortwährend nach unten korrigiert.[1] Die fadenscheinige Apologetik, neue Jobs würden eine Wende bei den Arbeitslosenzahlen einläuten, beißt sich mit den laufend revidierten Wachstumsprognosen, in denen die Schwäche sowohl der Länder mit hohem BIP wie auch der Schwellenländer zum Ausdruck kommt. Trotz beispielloser Konjunkturprogramme und Liquiditätsspritzen ist die globale wirtschaftliche Dynamik seit der Krise von 2007/08 bestenfalls mäßig ausgefallen. Die Investitionen stagnieren weitgehend, im Energiesektor wurden sie zuletzt dramatisch zurückgefahren.[2] Selbst Chinas Wirtschaft stottert und zeigt einen nachlassenden Rohstoffhunger.[3] Auch die vermeintliche Erfolgsgeschichte Deutschlands ist weniger Ausdruck nachhaltigen Wachstums als vielmehr Teil eines Prozesses prekärer Kapitalkonzentration einer im rapiden Niedergang befindlichen Eurozone.[4] Unterdessen setzt die Weltwirtschaft eine hemmungslose Verschuldung fort[5], die gemessen am BIP weiter wächst; in den entwickelten Ländern sind die öffentlichen und privaten Schulden laut dem International Centre for Monetary and Banking Studies 2013 auf 272 Prozent des BIP gestiegen.[6] Die jüngsten Deflations-Warnungen deuten daraufhin, dass die Schulden von Staaten, Unternehmen und Privathaushalten noch erdrückender werden könnten. Zu den höheren Haushaltsdefiziten kommt seit 2010 hinzu, dass die Zentralbanken mit frisch gedrucktem Geld Staats-, Unternehmens- und Immobilienanleihen aufkaufen – das sogenannte Quantitative Easing. Nach der Federal Reserve, der englischen und der japanischen Notenbank ist zuletzt auch die Europäische Zentralbank zu dieser Politik übergegangen, obwohl sie sich bislang nicht als wirksame Antwort auf nachlassendes Wirtschaftswachstum erwiesen hat. Stattdessen fließt das neu geschöpfte Geld in das Bankensystem, wo es die Bilanzen des Finanzkapitals stützt und Blasen bei den Vermögensposten verstärkt.
In diesen Phänomenen drückt sich die gegenwärtige Krise der Kapitalakkumulation aus, die zugleich eine Krise der Reproduktion des Verhältnisses von Kapital und Arbeit ist. Mit der Restrukturierung der Wirtschaft seit den 1970er Jahren wurden die Arbeitsmärkte flexibilisiert und die Rahmenbedingungen des Klassenverhältnisses grundlegend verschoben. Während die Arbeitslosigkeit in der Nachkriegsperiode relativ niedrig blieb – und der Sozialstaat gewisse Sicherheiten bot –, erfuhr die Entwicklung der Kapitalakkumulation einen beispiellosen Anstieg von Erwerbslosigkeit und Unterbeschäftigung.[7] Seit den frühen 1970er Jahren ist die kapitalistische Produktionsweise darauf ausgerichtet, durch die Auflösung des keynesianischen Deals, der Löhne und Produktivität aneinander koppelte, einem schmerzhaften Rückgang der Gewinne entgegenzuwirken. Um die Tendenz des Kapitals zur Untergrabung seines Selbstverwertungsprozesses hinauszuzögern, wurde eine Umstrukturierung in Gang gesetzt, die auf Expansion des Finanzkapitals und Steigerung der Ausbeutungsrate hinauslief. So eröffnete das 21. Jahrhundert mit dem Diktat der Abwertung von Arbeitskraft, was die beschriebenen Entwicklungen nur verschärft, und zusammen mit in Austerität mündenden Finanz- und Staatsschuldenkrisen die fortschreitende Verelendung intensivieren wird.
Die Krise von 2007/08 hat die materiellen Bedingungen der Lohnarbeit weiter verschlechtert; in den USA zum Beispiel liegt die Erwerbsbeteiligung auf dem niedrigsten Stand seit 36 Jahren[8], trotz der gefeierten Schaffung von Niedriglohnjobs. Für denjenigen Teil des Proletariats, der weder arbeitslos noch vollständig aus der aktiven Erwerbsbevölkerung herausgefallen ist – und somit in den Arbeitslosenstatistiken kaum noch auftaucht –, sind überwiegend prekäre und informelle Beschäftigungsformen ohne festes Einkommen im Angebot: Leih-, Teilzeit- und Saisonarbeit oder Selbständigkeit. Der gegenwärtige Überschuss an Kapital, welcher keine dauerhaften Investitionsmöglichkeiten mehr findet, verstärkt den effektiven Rückgang des Bedarfs nach Arbeitskraft. In der Kritik der politischen Ökonomie erfährt dieses Phänomen seinen systematischen Ausdruck im »allgemeinen Gesetz der kapitalistischen Akkumulation« (Marx): Mit dem Wachstum des Gesamtkapitals, das aus der Steigerung der Produktivität der Arbeit folgt, wird, gemessen an den Erfordernissen des Verwertungsprozesses, ein Großteil der Arbeitskraft überflüssig. Diese Tendenz entsteht aus dem Wesen des Kapitals schlechthin.[9] Es entfaltet die Arbeit als Anhängsel seines eigenen produktiven Vermögens und verringert die Menge notwendiger Arbeit, wodurch die Mehrwertrate erhöht wird. Relativ nimmt die Menge erforderlicher notwendiger Arbeit daher beständig ab. Dies vollzieht sich durch die wachsende organische Zusammensetzung des Kapitals: Die Konkurrenz zwischen den Einzelkapitalen bedingt eine Verallgemeinerung arbeitssparender Technologien wie der Automatisierung und führt so zu einer relativen Abnahme der Nachfrage nach Arbeitskraft.[10] Die Produktion dieser relativen Überschussbevölkerung ist gleichbedeutend mit einer Entwertung der Arbeitskraft insgesamt in Form einer Verdrängung der Arbeit aus dem Produktionsprozess sowie der Unmöglichkeit, sie durch die üblichen rechtlich regulierten Kanäle zu absorbieren. Wenn die Arbeitskraft des Proletariats sich nicht realisieren kann – wenn sie für die Realisierung des Kapitals nicht notwendig ist –, dann erscheint sie außerhalb der Bedingungen ihrer eigenen Reproduktion gesetzt. Die Reproduktion des Proletariats gerät in eine Krise; die Bedürfnisse sind allgegenwärtig, doch es mangelt ihm an Mitteln, diese angemessen zu erfüllen.[11]
Wie Freundinnen und Freunde angemerkt haben[12], ist die Überschussbevölkerung ein notwendiges Produkt der Kapitalakkumulation und somit eine strukturelle Kategorie, die sich aus dem Verhältnis von notwendiger Arbeit und Mehrarbeit ergibt. Diese Tendenz ist immer schon gegeben und unabhängig von seiner jeweiligen historischen Gestalt konstitutiv für das Kapitalverhältnis. Was rechtfertigt es dann, sie gerade in der gegenwärtigen Konstellation zu betonen? Schließlich ist der Gedanke einer Überschussbevölkerung bereits im »Begriff des freien Arbeiters« angelegt: in diesem »liegt schon, dass er Pauper ist: virtueller Pauper« (Grundrisse). Zu zeigen ist, warum die relative Überschussbevölkerung paradigmatisch für das Klassenverhältnis der Gegenwart ist und was dies für die heutigen Formen des Klassenkampfs bedeutet.
Die Schwierigkeit einer Kategorie
Mit der Umstrukturierung der 1970er Jahre hat sich das spektakuläre Bild von wachsendem Wohlstand und Vollbeschäftigung, von einer immer stärkeren Integration in die Sphären von Produktion und Konsumtion, umgekehrt. Seitdem steht der unverminderten Zentralität der Produktion eine strukturell geschwächte Position der Beschäftigten gegenüber. In den Nachkriegsdekaden, als die Situationistische Internationale ihre Kritik formulierte, hatte sich die spektakuläre Erscheinung des Proletariats von der Rolle des Arbeiters zu der des Konsumenten verschoben. Heute besteht sie dagegen in der »Exklusion«: Teile der Bevölkerung haben wenig Aussichten, jemals wieder unter Bedingungen ausgebeutet zu werden, die sie zu respektablen Verbrauchern machen würden. Marx unterschied in seiner Darstellung des »allgemeinen Gesetzes der kapitalistischen Akkumulation« zwischen flüssiger, latenter und stockender Überschussbevölkerung und schließlich dem Pauperismus. Schon damals ging es also um eine Vielfalt von Arbeitsverhältnissen, die mehr oder weniger dynamisch zwischen den Polen von Beschäftigung und Arbeitslosigkeit oszillieren. Vom unbeständigen Charakter der Saison-, Teilzeit-, informellen und selbständigen Arbeit[13] bis zum dubiosen Unternehmertum der sharing economy[14] oder dem unbezahlten Praktikum, von der ländlichen Arbeitsmigration bis zu den Slumbewohnern der urbanen Ballungsräume, vom grotesken Angebot des Islamischen Staates, die Bildungskredite neuer Rekruten zu tilgen[15], bis zur allgemeinen Unsicherheit, der sich jüngere Generationen gegenübersehen – das heutige Proletariat ist von einem beispiellosen objektiven Druck zur Entwertung seiner Arbeitskraft geprägt, welche seine Reproduktionsbedingungen zunehmend in Frage stellt. Eine trennscharfe Linie zwischen Beschäftigung und Arbeitslosigkeit zu ziehen, führt daher vollkommen in die Irre, wenn wir begreifen wollen, wie die Dynamik der Überschussbevölkerung aus der historischen Entwicklung der Kapitalakkumulation hervorgeht. Um der Versuchung zu widerstehen, uns einfach an die Unmittelbarkeit des Gegebenen zu halten soll im Folgenden versucht werden, den Begriff der relativen Überschussbevölkerung als Kategorie der gesellschaftlichen Vermittlung zu fassen, durch die sich die sich die selbst reproduzierende Totalität des Kapitals entfaltet.
Adorno bemerkte einmal, dass »Gesellschaft unmittelbar da fühlbar wird, wo es weh tut«. Es besteht kein Mangel an sensationell aufbereiteten, bewegenden Bildern struktureller Arbeitslosigkeit. Sich an die Unmittelbarkeit moralisierender Begriffe wie Diskriminierung, Exklusion und Verdrängung zu klammern, zielt bestenfalls auf eine gerechtere Verteilung der Ausbeutung. Vielgefeierte politische Akteure wie die »Multitude«, das »Prekariat« oder die »Ausgeschlossenen« – die letztlich alle unter dem Banner der Vollbeschäftigung die Ungleichheit bezwingen sollen – vernebeln die Wahrheit des Klassenverhältnisses, während sie sich einem bornierten Praktizismus im Dienste des schlichtweg Gegebenen andienen.[16] Symptomatisch für solch oberflächliche Betrachtungen ist die Abkehr vom Kommunismus zum Egalitarismus und Kommunitarismus, von der Kritik zur moralischen Betroffenheit. Identitäre Trennlinien entlang einer Skala von Privileg und Unterdrückung haben wenig theoretisches Gewicht, und erschöpfen sich in einer alibihaften Glorifizierung der Marginalisierten und in der Verdinglichung des Elends. Auch wenn sich das Wesen einer Kategorie nur durch ihre Erscheinungsformen begreifen lässt, muss kritische Reflexion über das unmittelbar Gegebene hinausgehen, ohne sich in leere Abstraktionen zu flüchten.[17]
Marx’ Begriff der relativen Überschussbevölkerung ist keine soziologische Allerweltskategorie, sondern bezieht sich auf ein strukturelles Phänomen einer widersprüchlichen Totalität. Die empirisch gegebenen Bedingungen der kapitalistischen Produktionsweise sind lediglich Momente, durch die sich methodisch die objektiven, gesetzmäßigen Tendenzen des Kapitals erschließen lassen, das die Bedingungen seiner eigenen Existenz setzt. Wie schon bemerkt worden ist: »Das Konkrete ist konkret, weil es die Zusammenfassung vieler Bestimmungen ist, also Einheit des Mannigfaltigen.« (Grundrisse, S. 21) Die Kategorien der Kritik der politischen Ökonomie lassen sich nicht auf eine empiristische Perspektive reduzieren, für die allein quantifzierbare Fakten gültig wären. Gegen einen Positivismus, der soziale Tatsachen als etwas an sich Gegebenes unterstellt, gilt es die unmittelbare Situation der Überschussbevölkerung auf tieferreichende Vermittlungen hin zu entschlüsseln. Diese liegen im Begriff der Klasse, insoweit er nicht eine Ansammlung von Individuen bezeichnet, die bestimmte Eigenschaften wie Einkommen, Bewusstsein, kulturelle Gewohnheiten etc. teilen, sondern ein antagonistisches Verhältnis zwischen Kapital und Arbeit, welches das Leben der Einzelnen strukturiert.[18] Eine »Zugehörigkeit« zur Klasse kann es streng genommen nicht geben. Ein solches Verständnis gibt unweigerlich die Perspektive der Totalität preis, ohne die der Klassenbegriff zu einem räumlichen Schema voneinander abgegrenzter »Sphären«, »Ebenen« oder »Instanzen« verkümmert. Auszugehen ist nicht von einer monokausalen Bestimmung, sondern vielmehr von unterschiedlichen Momenten der Totalität des Klassenverhältnisses von Kapital und Arbeit, aus dem sich das Phänomen der relativen Überschussbevölkerung ableitet.
Bei der Analyse der Überschussbevölkerung wird deutlich, dass eine wohlgeordnete, durch quantifizierbare Fakten [s.o.] aufpolierte Zusammenstellung sozialer Tragödien keinen Ersatz für substantielle Kritik bietet. Obgleich keine empirische Kategorie, schließt dieser Begriff der relativen Überschussbevölkerung das Konkrete in sich ein. Sie ist zugleich konkret und abstrakt, ebensowohl direkt zu beobachten wie allgemeines Moment des Akkumulationsprozesses.[19] Das Surplus-Proletariat ist eine qualitative Kategorie der Produktivität der Arbeit innerhalb der kapitalistischen Produktionsweise, die quantitative Dimensionen hat, weil diese Produktivität durch das Verhältnis von konstantem und variablem Kapital bestimmt wird. Ohne ein solches Verständnis läuft man Gefahr, auf die Annahme zurückzufallen, Beschäftigte und Arbeitslose seien zwei unterschiedliche Bevölkerungsgruppen und nicht Ausdruck einer Dynamik des Kapitalverhältnisses. Kennzeichnend für diese Dynamik ist die Unsicherheit, die eigene Arbeitskraft geltend machen zu können, gegen das vorrangige Bedürfnis des Kapitals, die Mehrarbeit auszuweiten; sie ist nicht mit einem soziologischen Schema zur Klassifizierung von Individuen zu begreifen. Es ist bereits darauf hingewiesen worden, dass Mike Davis’ Charakterisierung des Phänomens als ein »Kontinuum« treffender ist als eine scharfe Unterscheidung von Beschäftigten und Arbeitslosen.[20] Definieren wir das Surplus-Proletariat als ein solches Kontinuum, dann lässt es sich als eine allgemeine Dynamik des Kapitalverhältnisses fassen, die zur Folge hat, dass sich die Individuen hektisch getrieben durch das gesamte Spektrum von Arbeitslosigkeit, Unterbeschäftigung und Arbeit bewegen – prekäre Übergänge, die schneller denn je aufeinander folgen. Aus diesem Grund drückt das Surplus-Proletariat die Wahrheit der Klassenmobilität aus. Entscheidend ist, die strikte Trennung zwischen Beschäftigten und Arbeitslosen, als handele es sich dabei um statische soziale Positionen innerhalb der Ökonomie, aufzubrechen. Denn das Problem des Surplus-Proletariats lässt sich nicht auf die scheinbar einfache Frage reduzieren, wer arbeitet und wer nicht, sondern stellt eine Dynamik dar, die all diese Positionen durchzieht und hervorbringt. Die Verdrängung aus formal geregelten Arbeitsmärkten entspringt einem Widerspruch innerhalb des Lohnarbeitsverhältnisses selbst; die von chronischer Arbeitslosigkeit Betroffenen sind ebenso sehr Teil der Produktion wie ihr Produkt. Arbeitslosigkeit muss daher als eine Kategorie der Ausbeutung gefasst werden und nicht als etwas ihr Äußerliches. Zudem bietet die diffuse Unterbeschäftigung dem Kapital ein Mittel zur Disziplinierung der scheinbar stabil Beschäftigten, zur Senkung des Werts der Ware Arbeitskraft und zur Erhöhung der Ausbeutungsrate. Die Beschäftigten müssen »entdecken, daß der Intensitätsgrad der Konkurrenz unter ihnen selbst ganz und gar von dem Druck der relativen Übervölkerung abhängt« (Marx). Insofern ist das Surplus-Proletariat keineswegs überflüssig. Es stellt eine Dynamik innerhalb des Proletariats dar, die seinem Begriff wesentlich inhärent ist. Wie der objektive Antagonismus des Klassenverhältnisses selbst durchzieht dieses Phänomen das Leben jedes Einzelnen, ohne dass es auf eine Frage von Identitäten reduzierbar wäre. Somit ist die Totalität des Surplus-Proletariats, wie es aus dem Kapitalverhältnis und dem Zwang zur Entwertung der Arbeitskraft insgesamt hervorgeht, in allen Individuen gegenwärtig.[21]
Das Surplus-Proletariat heute
Das Neuartige an der heutigen Erzeugung des Surplus-Proletariats lässt sich aus den drei Blickwinkeln von Arbeitskraft, Kapital und Staat fassen, die jeweils bestimmte Facetten der gegenwärtigen Kluft zwischen Angebot und Nachfrage nach Arbeitskraft offenbaren. Heute erfolgt der Zugang zum Arbeitsmarkt unter Bedingungen einer solchen Flexibilisierung und Prekarisierung, dass die meisten Beschäftigten de facto bereits halb arbeitslos sind. Die Betätigung des Surplus-Proletariats auf dem Markt setzt ebenso dessen Ausschluss voraus. Der dröhnende Unternehmerdiskurs, der jedem verspricht Lehrer, Taxifahrer oder Motel-Manager werden zu können, verdeutlicht vor allem die verschärfte Konkurrenz unter den Arbeitskräften. Ehemals als Zeichen von Erfolg betrachtet, zeugt Selbständigkeit heute von einer voranschreitenden Atomisierung, die all zu oft noch tiefer in die Prekarität führt. Seit den 1990er Jahren kommt hinzu, dass diejenigen, die aufgrund der mauen Arbeitsmarktsituation nahe oder unter der Armutsgrenze leben, zunehmend auf niedrig verzinste Verbraucherkredite angewiesen sind, um ihr dürftiges Einkommen aufzubessern.
Aus all diesen Gründen kann man sagen, dass die genannten Umstrukturierungen für das Proletariat eine qualitative Verschiebung von einer Existenz als virtuelle Pauper zur konkreten Lumpenproletarisierung bewirkt hat.[22] Kennzeichnete das Surplus-Proletariat Mitte des 19. Jahrhunderts noch die potentielle Pauperisierung des freien Arbeiters, bedeutete die Umstrukturierung der 1970er und 1980er Jahre die konkrete Verwirklichung des virtuellen Paupers als permanente Bedingung des Proletariats im Verhältnis zum Kapital. Dergestalt verweist das Surplus-Proletariat auf die gegenwärtigen Probleme der Arbeitskraft, sich durch das Lohnverhältnis, und aufgrund dieses Verhältnisses, zu vergesellschaften. Der Tendenz nach drücken sich die antagonistischen Verhältnisse innerhalb des Surplus-Proletariats zudem entlang der Linien von Geschlecht, Ethnie und Generation aus.[23]
Diese Entwicklungen auf den Arbeitsmärkten zeigen eine Krise der Reproduktion der Arbeitsbevölkerung an. Marx zufolge ist es das Mittel der Beschäftigung, welches das Surplus-Proletariat charakterisiert: »dies ist aber allgemeiner zu fassen und bezieht sich überhaupt auf die soziale Vermittlung, durch welche das Individuum sich auf die Mittel zu seiner Reproduktion bezieht und sie schafft” (Grundrisse). Versuche, das Surplus-Proletariat schlicht als bestimmte, empirisch fixierbare Stellung im Produktionsprozess zu definieren, verfehlen seine Dynamik mit Blick auf die gesellschaftliche Vermittlung und die Sphäre der Reproduktion. Wenn das Kapital heute nicht mehr in ausreichendem Maß reguläre Lohnarbeit gewährleisten kann, gerät das Proletariat auf Ebene seiner Reproduktion in eine Krise. Insofern drückt sich im Surplus-Proletariat ein Angriff des Kapitals auf die Reproduktion von Arbeitskraft aus – ein deutlicher Kontrast zur Sozialdemokratie der Nachkriegsdekaden, in denen höhere Löhne und Sozialausgaben kennzeichnend für die Ausbeutungsbedingungen waren. Seitdem hat das Kapital seine Übereinkunft mit den Lohnabhängigen aufgekündigt, die diese in den Akkumulationsprozess integrieren sollte. Dieser Bruch in der Reproduktion des Klassenverhältnisses lässt sich auch als Reaktion auf den Zyklus der Klassenkämpfe der 1960er und 1970er Jahre verstehen, durch die das Proletariat diese Übereinkunft – die Kopplung von Löhnen und Produktivität – strapazierte, indem es immense Lohnsteigerungen durchsetzte und so die Kosten seiner Reproduktion in die Höhe trieb.[24] Im Gegensatz zur damaligen Situation besteht der gegenwärtige Ausdruck des Surplus-Proletariats in einer dauerhaften Entwertung von Arbeitskraft, die unauflöslich mit der durch die Krise beschleunigten Entwertung von Kapital verbunden ist. Das Proletariat der weltweiten Slums und Ghettos ist lediglich die verdichtete Erscheinung dieser allgemeinen Krise der Reproduktion. Dieser Prozess, von Robert Kurz als »Entwertungsspirale« bezeichnet,[25] bestimmt die Konturen einer Ära schwachen Wachstums, das mit der Ausbreitung des Surplus-Proletariats und seiner Krise der Reproduktion einhergeht.[26] Die sicherste Prognose lautet, dass sich die Lage in den kommenden Jahrzehnten Schritt für Schritt weiter verschlechtern wird.
Das relative Surplus-Proletariat geht als Dynamik des Kapitalverhältnisses aus der gegenwärtigen Krise hervor. Der schlichte Verweis auf eine »industrielle Reservearmee« bietet wenig Aufschluss über die heutige Konstellation, denn die Rede von einer Reserve deutet auf eine mögliche Reintegration hin, die für weite Teile des Surplus-Proletariats längst nicht mehr gilt; sein Wachstum lässt sich nicht allein als Krise der Arbeitskraft fassen, sondern zeigt auch die aktuellen Grenzen der Akkumulation des Kapitals an.[27] Diese Krise nötigt das Kapital dazu, die Arbeit produktiver zu machen und so den Anteil der notwendigen Arbeit zu senken, was – in Marxschen Begriffen gefasst – eine Steigerung der organischen Zusammensetzung des Kapitals bedeutet. Die Kehrseite der Medaille besteht darin, dass das Kapital damit zugleich die Voraussetzung seiner eigenen Verwertung untergräbt: menschliche Arbeitskraft.
Hinzu kommt, dass die – vor allem durch die Liberalisierung der Finanzmärkte geförderten – Industrialisierungsprozesse der letzten Dekaden kaum arbeitsintensiv waren: Gemessen an früheren Phasen und Industrien des 20. Jahrhunderts ist die Zahl der beschäftigten Proletarier relativ gering ausgefallen. In den BRICS-Staaten (Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika) zum Beispiel war zwar bis vor kurzem noch eine schnellere Kapitalakkumulation zu beobachten als in den bereits entwickelten Wirtschaften; besonders China und Indien konnten hohe Wachstumsraten verzeichnen, die mit beachtlichen geographischen Verschiebungen in der globalen industriellen Produktion und Beschäftigung einhergingen. Doch gemessen an der Gesamtbeschäftigung haben die Industriejobs kaum zugenommen[28]; jenseits der Landwirtschaft arbeiten die meisten im Dienstleistungssektor, besonders in Brasilien. In China und Indien etwa sind kaum 15 Prozent der Erwerbsbevölkerung in der Industrie beschäftigt. Zudem hat die Zahl der chinesischen Proletarier, die überhaupt einer Arbeit nachgehen, gemessen an der Gesamtbevölkerung seit den 1990er Jahren allmählich abgenommen.[29] Das industrielle Wachstum in dieser Phase hat die Industriearbeiterschaft nicht automatisch vergrößert, sondern eher verkleinert. Während in Chinas älteren Industrien Arbeitsplätze verloren gingen – auch durch Verlagerungen in südostasiatische Länder wie Kambodscha, Vietnam und Bangladesch, wo die Entwertung von Arbeitskraft noch stärker ausfällt –, haben die neu entstehenden Zweige „gemessen am Produktionsausstoß (…) weniger Arbeitskräfte absorbiert“[30] Marx‘ Beschreibung einer latenten Überschussbevölkerung weist bemerkenswerte Ähnlichkeit mit den urbanisierten chinesischen Wanderarbeitern auf[31], die – infolge der Kapitalisierung der Landwirtschaft – gezwungen sind, auf der Suche nach ungewisser Beschäftigung durchs Land und über fremde Kontinente zu ziehen.[32]
Die Stagnation der weltweiten Industriebeschäftigung geht, gemessen an der gesamten Erwerbsbevölkerung, mit der Ausweitung von schlecht bezahlten Dienstleistungsjobs einher, in denen das Surplus-Proletariat flexiblen Arbeitsverhältnissen unterworfen ist. So mag die kapitalistische Entwicklung der Schwellenländer zwar die absolute Zahl der Armen reduzieren, aber sie bringt vor allem Niedriglohnjobs hervor. In Indien bleibt zunehmende Unterbeschäftigung die Regel, auch wenn der wachsende IT-Sektor das Bruttoinlandsprodukt steigert. Zudem konnten die BRICS-Länder in der Vergangenheit durch Staatsausgaben die Realität einer Industrialisierung verbergen, deren Absorption von Arbeitskraft hinter der Kapitalakkumulation zurückblieb. Diese Sicherheitsnetze, vor allem die Subventionierung von Grundnahrungsmitteln, lösen sich heute durch Privatisierung und Sparpolitik weitgehend auf.
Das Hauptproblem des Kapitals in der gegenwärtigen Krise lässt sich als Tautologie ausdrücken: Es ist gezwungen, die Arbeit produktiver zu machen, und dazu benötigt es mehr Kapital. Vor dem historischen Hintergrund einer bereits sehr hohen organischen Zusammensetzung jedoch ist das zur Erzielung eines bestimmten Profits benötigte Kapitalminimum zu hoch. Um mehr Kapital für die erforderlichen Investitionen zu bekommen, muss das Kapital die Produktivität der Arbeit erhöhen. Aufgrund dieser Tautologie oder Aporie flieht das Kapital zunehmend aus der Produktionssphäre und findet Zuflucht auf den Finanzmärkten, wo sich durch Spekulation mit Währungen, Staatsanleihen, Immobilienanlagen und dergleichen scheinbar einfacher Gewinne erzielen lassen. Diese Tendenz lässt sich auch als Flucht vor dem strengen Regiment des Wertgesetzes beschreiben – eine Flucht, die letztendlich nicht gelingen kann.
Die aktuelle Krise nimmt die Erscheinungsform einer allgemeinen Entwertung an, die eine Neujustierung der Ausbeutungsbedingungen nach sich zieht und durch exorbitante Staatsausgaben in die finanzpolitische Sackgasse führt. Der Staat ist zugleich Voraussetzung und Resultat der Bedingungen der Kapitalakkumulation. So drückt sich die derzeitige Krise auch als Krise des Staates aus, die wiederum in Gestalt von Konjunkturprogrammen, Liquiditätsspritzen, Austerität und schlussendlich Repression erscheint. Wo sich das Kapital zurückzieht, tritt die Polizei auf den Plan. In diesem Kontext geht die staatliche Verwaltung des Surplus-Proletariats mit einer weltweiten geographischen Segmentierung der Arbeitskräfte einher, die angesichts immenser Migrations- und Flüchtlingsströme sowie der gesellschaftlichen Arbeitsteilung zwischen urbanen Zentren und Vorstädten noch an Bedeutung gewinnen dürfte.
Der Zweite Weltkrieg entschärfte die Krise durch eine massive Zerstörung und Entwertung von Kapital. Nach dem Krieg zielte der Staat in erster Linie darauf ab durch immer größere schuldenfinanzierte Ausgaben, den keynesianischen Deal zwischen Kapital und Arbeit – die Kopplung von Löhnen und Produktivität – sicherzustellen.[33] Nachdem dieser Deal mit der Krise der 1970er Jahre an sein Ende kam, zeigten die Jahre 2007/08 noch einmal, die Nutzlosigkeit einer solchen Strategie wenn es darum geht, reales Wirtschaftswachstum zu erreichen. Heute besteht die Funktion des Staates, ungeachtet etwaiger sozialdemokratischer Posen[34], in der Fortsetzung von Sparprogrammen, durch die er seinen Anteil an den Kosten der Reproduktion der Arbeitskräfte senkt – eine Politik, die zwangsläufig mehr Kriminalisierung und Repression nach sich zieht.[35] Als Vermittler einer Entwertung von Arbeitskraft tritt er gegenwärtig am eindrücklichsten in südeuropäischen Ländern auf, die von ihren Gläubigern unter anderem dazu gezwungen werden, die Zahl der gesetzlichen Feiertage, Zulagen für Überstunden und Abfindungspakete zu reduzieren, Tarifverträge aufzubrechen und allgemein die Sozialausgaben, also den indirekten Lohn, zu senken. Da die Möglichkeit einer politischen Vermittlung tendenziell verschwindet, büßt der Staat seine Integrationskraft ein. Es ist daher kein Zufall, dass soziale Kämpfe in den letzten Jahren immer häufiger auf eine direkte Konfrontation mit dem Staat hinausliefen.[36] In der Vergangenheit konnte der Staat Krisen eindämmen. Heute dagegen ist die keynesianische Lösung keine Option mehr, weil ihm nach der Rettung von Privatunternehmen und seiner massiven Verschuldung in der Nachkriegsperiode selbst der Bankrott droht. In der Vergangenheit konnte die Reproduktion des (Surplus-)Proletariats durch die staatliche Umverteilung von Mehrwert in Gestalt von Sozialleistungen und anderen Ausgaben vermittelt werden; bei diesem Modell, das bis zur ökonomischen Umstrukturierung der 1970er Jahre eine gewisse Plausibilität besaß, wurde sein indirekter Lohn durch Besteuerung aus der Privatwirtschaft abgeschöpft. Heute dagegen steckt der Staat selbst in einer Krise und kann die Reproduktion der Arbeitskräfte nicht mehr gewährleisten. Dieses Unvermögen ist Ausdruck einer globalen Abwertung von Arbeitskraft, die zum beispiellosen Aufruhr seitens einer Generation von Surplus-Proletariern mit düsteren Zukunftsaussichten führt.
Der Kampf des Surplus-Proletariats
Wir möchten vor zwei Sackgassen warnen: Die Idealisierung der proletarischen Lebens- und Arbeitszusammenhänge in ihrem vergangenen Glanz oder aber in ihrer heutigen Flüchtigkeit sind letztlich zwei Seiten derselben Medaille. Zunächst sollte die vorliegende Auseinandersetzung mit dem Phänomen des heutigen Surplus-Proletariats keineswegs als Lamento über die Marginalisierung einer Figur verstanden werden, die man sich häufig als klassischen produktiven Arbeiter mit immenser Verhandlungsmacht vorstellt und die frühere Phasen tatsächlich geprägt haben mag. Wenn überhaupt, verweisen die gegenwärtigen Konstellationen und die Dynamik des Surplus-Proletariats auf das Elend einer solchen Überhöhung des machtvollen Arbeiters. Es geht nicht um den Versuch, frühere Bedingungen der Ausbeutung wiederherzustellen, sondern um eine Auseinandersetzung mit den historischen Grenzen, an die die Reproduktion des Klassenverhältnisses heute stößt. Die Produktion des Kommunismus ist nicht die Glorifizierung der Arbeit, sondern ihre Abschaffung. Spiegelbildlich zu einem solchen ziellosen Lamento verhält sich die Überhöhung des Surplus-Proletariats zu einem einzigartigen revolutionären Subjekt, das vollbringen kann, was den anderen – die noch das Glück der früheren Ausbeutungsbedingungen genießen – zwangsläufig verwehrt bleibt. Selbst wenn heute mit dem Surplus-Proletariat auch die Riots zunehmen, ist das kein Grund, sich in romantischer Projektion einen Akteur mit klarer Identität auszumalen, der näher am Kommunismus sei als jene, die noch in einer glücklicheren Lage sind.[37] Auch die Bessergestellten können schnell und unsanft auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt werden.
Die Dynamik des Surplus-Proletariats ist eine Dynamik der Fragmentierung – ein Prozess, der gemäß den Veränderungen des Kapitals und der Entwertung von Arbeitskraft innere Transformationen des Proletariats insgesamt hervorruft und dessen unterschiedliche Beziehungen zum Produktionsprozess betrifft.[38] Infolgedessen sind heutige Klassenkämpfen oftmals getragen von Menschen mit sehr unterschiedlichen Erfahrungen und Hintergründen, was oft Konflikte nach sich zieht. Dieses Problem der Klassenzusammensetzung zeigt sich vielleicht am deutlichsten in Konflikten, die die sogenannte Mittelschicht und ihre Angst vor einem Abstieg in weniger günstige Ausbeutungsverhältnisse betreffen. Ihre Krise, die sich auch im Ruf nach gerechterer Verteilung ausdrückt, ist selbst ein Moment der Totalität des Surplus-Proletariats, d.h. sie vollzieht sich in und durch die innere Fragmentierung des Proletariats. Das heutige Problem des Surplus-Proletariats wirft somit die Frage nach dem Interklassismus als einer Dynamik der gegenwärtigen Kämpfe des Proletariats auf, dessen fragmentierter Charakter häufig als eine Grenze erscheint.
Dieses Problem wird oft als eines der Zusammensetzung beschrieben, d.h. der Schwierigkeit, verschiedene Fraktionen des Proletariats im Zuge von Kämpfen zu vereinen. Der Inhalt der Revolution ist heute nicht mehr als Triumph einer ständig zunehmenden proletarischen Klassenmacht vorstellbar, wie es in der ersten Hälfte des 20.Jahrhunderts vielleicht der Fall war.[39] Davon zeugen Kämpfe, die immer häufiger nicht in der Produktions-, sondern in der Reproduktionssphäre stattfinden. Der arabische Frühling, die Indignados, Occupy, Taksim, Maidan und die ganz unterschiedlichen Riots in anderen Ländern waren nicht davon geprägt, dass Arbeiter im Konflikt mit dem Kapital ihre Identität als Arbeiter behauptet hätten, sondern vielmehr davon, dass aus ihrer Dynamik keinerlei vereinheitlichende Identität hervorging. Auch die jüngeren Proteste gegen rassistische Polizeigewalt in den Vereinigten Staaten, namentlich in Ferguson und Baltimore, haben wenig mit früheren Arbeitskämpfen gemein. Verstärkt wird dies durch das gleichzeitige Anwachsen des Surplus-Proletariats sowie des überschüssigen Kapitals, das keine dauerhaften Investitionsmöglichkeiten mehr findet. Die Arbeiterbewegung bietet dem Klassenkampf keine vereinheitlichende Klammer mehr. Eine solche besteht heute vielmehr gerade in der Fragmentierung. Gegenwärtige Kämpfe drücken sich weniger in einer festen Zusammenschluss aus als in einer Bündelung unterschiedlicher Interessen entlang der materiellen Reproduktion (Zwangsräumungen, Lebensmittelpreise, Transportkosten), durch abstrakte Forderungen (gegen »Korruption«, »Ungleichheit«, »Ungerechtigkeit«) oder durch opferbereite Identifikation mit falschen Fragmenten, die das soziale Ganze verkörpern sollen (Nation oder Religion). Infolgedessen ist die Zentralität der Lohnforderung, durch die sich frühere Kämpfe auszeichneten, heute peripher geworden. Das Surplus-Proletariat, verstanden als Dynamik des Klassenkampfs in der gegenwärtigen Situation, hat die Träume von einem keynesianischen Klassenkompromiss eigentlich schon aufgegeben. Die Selbstaffirmation des Proletariats als Klasse ist beständig auf dem Rückzug.
Es sollte deutlich geworden sein, dass der Begriff des Surplus-Proletariats nicht einfach auf die empirische Frage nach bestimmten Gruppen und ihrer Zusammensetzung verweist. Solche soziologisch gefassten Identitäten sind selbst bloß Momente der Reproduktion einer Totalität des Klassenverhältnisses. Die Entwertung deren Arbeitskraft entfaltet sich dabei gegenwärtig durch die Kategorie des Surplus-Proletariats. Wichtiger für kommunistische Theorie ist die Frage, was die Personifikationen dieser Kategorie gegen ihr eigenes Dasein tun – wieweit sie als eine negative Bewegung wider die eigene proletarischen Lage auftreten und angesichts der Krise ihrer Reproduktion eine Klasse gegen sich selbst bilden. Offen bleiben muss vorerst, wie die konkrete Entwicklung des Surplus-Proletariats, die mit der sich entfaltenden Krise des Kapitals zusammenfällt, die Spaltung und Fragmentierung des Proletariats verstärkt und entlang welcher Linien dies in den heutigen Kämpfen geschieht (seien es Gegensätze zwischen Regionen, qualifizierter und unqualifizierter Arbeit, oder die Stigmatisierung von Altersgruppen, Ethnien, Geschlechtern etc.). Insofern wirft der Begriff die Frage auf, wie die enteignete und ausgebeutete Klasse in der gegenwärtigen Situation – trotz ihrer zunehmenden Spaltung – an und gegen sich als Klasse des Kapitals handeln kann. So betrachtet ist das Surplus-Proletariat lediglich die jüngste Erscheinung des Proletariats als solchem – dessen Wesen weiterhin darin besteht, in der Trennung von den Mitteln seiner eigenen Reproduktion vereint zu sein.
Surplus Club
Frankfurt am Main, Frühjahr 2015
[1] Der »IWF hat seine Wachstumsprognosen für die Weltwirtschaft angesichts einer Abkühlung in China, einer drohenden Rezession in Russland und der anhaltenden Schwäche der Eurozone gesenkt«. <http://www.theguardian.com/business/2015/jan/20/imf-cuts-global-economic-growth-forecast>. Die International Labor Organization »prognostiziert für die kommenden Jahre mit Blick auf die globale Beschäftigung eine düstere Situation« <http://blogs.wsj.com/economics/2015/01/21/world-economy-needs-280-million-jobs-in-next-five-years-ilo-says/>. Nicht besser sind die Aussichten für Lateinamerika: der IWF »erwartet für 2015 einen wirtschaftlichen Rückgang in Venezuela und Argentinien und ein Wachstum von lediglich 0,3 Prozent in Brasilien; auch für 2016 hat er seine Wachstumsprognose für Lateinamerika von 2,8 auf 2,3 Prozent gesenkt.« <http://laht.com/article.asp?ArticleId=2370538&CategoryId=12394>. Besonders die brasilianische Wirtschaft nähert sich einer Implosion: Ökonomen haben »zum vierten Mal hintereinander ihre wöchentliche Prognose für die Inflation in diesem Jahr angehoben und die für das Wirtschaftswachstum gesenkt.« <http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-01-26/brazil-economists-raise-2015-cpi-cut-gdp-for-fourth-week-in-row>. Selbst Nordeuropa ist gegen den Wachstumsrückgang nicht immun: »Schwedens Regierung hat ihre Wachstumsprognosen nach unten korrigiert und geht davon aus, dass sie in den nächsten vier Jahren keinen Haushaltsüberschuss erreichen wird.« <http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-01-20/sweden-cuts-gdp-forecast-as-deficit-seen-stretching-past-2018>.
[2] »Chevron Tightens Belt as $40 Billion Makeover Sweeps Oil Sector«. < http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-01-30/chevron-profits-fall-to-lowest-since-2009-as-oil-prices-collapse>.
[3] »We Traveled Across China and Returned Terrified for the Economy«. < http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-04-09/we-travelled-across-china-and-returned-terrified-for-the-economy>.
[4] Der angeblich »stabile« Wirtschaftsboom in Deutschland beruht auf den Arbeitsmarktreformen der letzten Dekade, die die Reproduktionskosten der Arbeitskräfte deutlich gesenkt haben. Vgl. <http://foreignpolicy.com/2015/05/05/rich-germany-has-a-poverty-problem-inequality-europe>. Angesichts ihrer Exportabhängigkeit und geringen Lohnstückkosten könnte die vermeintliche Robustheit der deutschen Wirtschaft außerdem beim nächsten globalen Abschwung ein Ende haben: <http://blogs.lse.ac.uk/eurocrisispress/2015/03/12/germany-the-giant-with-the-feet-of-clay/>.
[5] »Debt mountains spark fears of another crisis«. <http://www.ft.com/intl/cms/s/0/2554931c-ac85-11e4-9d32-00144feab7de.html#axzz3QuNTKwet>.
[6] »Deleveraging, What Deleveraging? The 16th Geneva Report on the World Economy«. <http://www.voxeu.org/article/geneva-report-global-deleveraging>. In südeuropäischen Ländern ist die Verschuldung gemessen am BIP in den vergangenen drei Jahren um 15 Prozent gestiegen. »Germany faces impossible choice as Greek austerity revolt spreads.« <http://www.telegraph.co.uk/finance/economics/11407256/Germany-faces-impossible-choice-as-Greek-austerity-revolt-spreads.html>. Besonders bemerkenswert ist neuerdings die Verschuldung in China, die sich seit 2007 vervierfacht hat und mittlerweile bei 282 Prozent des BIP liegt; ihre Ursache besteht in latenten Überkapazitäten und vor allem in einem überhitzten Immobilienmarkt. »Debt and (not much) deleveraging«. <http://www.mckinsey.com/insights/economic_studies/debt_and_not_much_deleveraging> and »How addiction to debt came even to China«. <http://www.ft.com/intl/cms/s/0/585ae328-bc0d-11e4-b6ec-00144feab7de.html#axzz3SjqvVqAV>.
[7] »Most of the world’s workers have insecure jobs, ILO report reveals«. <http://www.theguardian.com/business/2015/may/19/most-of-the-worlds-workers-have-insecure-jobs-ilo-report-reveals>.
[8] »The December Jobs Report in 10 Charts«. http://blogs.wsj.com/economics/2015/01/09/the-december-jobs-report-in-10-charts>.
[9] Wie Marx schreibt: „Die Vermehrung der Produktivkraft der Arbeit und die größte Negation der notwendigen Arbeit ist die notwendige Tendenz des Kapitals.» (Grundrisse)
[10] Zu betonen ist hier, dass es sich um eine relative Abnahme handelt – selbst wenn das Kapital die absolute Zahl der Beschäftigten steigert, geschieht dies dem allgemeinen Gesetz der kapitalistischen Akkumulation zufolge langsamer als die allgemeine Rate der Akkumulation. Dies bedeutet, dass »die Arbeiterbevölkerung stets rascher wächst als das Verwertungsbedürfnis des Kapitals«, und dass »im Maße wie Kapital akkumuliert, die Lage des Arbeiters, welches immer seine Zahlung, hoch oder niedrig, sich verschlechtern muss.« (Das Kapital Band I, S 674 f.)
[11] Wie Marx schreibt: „Das Arbeitsvermögen kann nur seine notwendige Arbeit verrichten, wenn seine Surplusarbeit Wert für das Kapital hat, verwertbar für es ist. Ist diese Verwertbarkeit daher durch eine oder die andre Schranke gehemmt, so erscheint das Arbeitsvermögen selbst 1. außer den Bedingungen der Reproduktion seiner Existenz; es existiert ohne seine Existenzbedingungen und ist daher a mere encumbrance; Bedürfnisse ohne die Mittel, sie zu befriedigen; 2. die notwendige Arbeit erscheint als überflüssig, weil die überflüssige nicht notwendig ist. Notwendig ist sie nur, soweit sie Bedingung für die Verwertung des Kapitals.» Desweiteren ist hervorzuheben, dass dieser Druck, die eigenen Bedürfnisse befriedigen zu müssen, Resultat des krisenhaften Charakters der Tauschbeziehung ist. »daß es also die means of employment und nicht of subsistence sind, die ihn in die Kategorie der Surplus-Population stellen oder nicht. Dies ist aber allgemeiner zu fassen und bezieht sich überhaupt auf die soziale Vermittlung, durch welche das Individuum sich auf die Mittel zu seiner Reproduktion bezieht und sie schafft; also auf die Produktionsbedingungen und sein Verhältnis zu ihnen.« (Grundrisse 1. Zitat auf S.502; 2. Zitat auf S. 501 in meiner Ausgabe – Europäische Verlagsanstalt, Frankfurt, die mit der MEW-Ausgabe nicht identisch ist)
[12] Reflexionen über das Surplus-Proletariat, Kosmoprolet 4
[13] »One in Three U.S. Workers Is a Freelancer« < http://blogs.wsj.com/atwork/2014/09/04/one-in-three-u-s-workers-is-a-freelancer/>.
[14] »Against Sharing«. <https://www.jacobinmag.com/2014/09/against-sharing>.
[15] »ISIS Paying Off Student Debt to Lure American Recruits«. <http://dailycurrant.com/2015/01/20/isis-paying-off-student-debt-to-lure-american-recruits>.
[16] Wie Adorno schreibt: »Am tiefsten dürfte der Nominalismus der Ideologie darin verhaftet sein, daß er Konkretion als Gegebenes, zweifelsfrei Vorhandenes traktiert und sich und die Menschheit darüber täuscht, daß der Weltlauf jene friedliche Bestimmtheit des Seienden verhindert, die vom Begriff des Gegebenen nur usurpiert und ihrerseits mit Abstraktheit geschlagen wird.« (Ästhetische Theorie, S. 203)
[17] Wie Zamora bemerkt, werden »die Kategorien der ‚Arbeitslosen‘, ‚Armen‘ oder ‚Prekären‘ rasch abgetrennt von der Ausbeutung, die den Kern kapitalistischer ökonomischer Verhältnisse bildet, und stattdessen als relative (finanzielle, soziale oder psychologische) Deprivation gefasst und unter den allgemeinen Rubriken von ‚Exklusion‘, ‚Diskriminierung‘ oder Formen der ‚Beherrschung‘ abgeheftet«. Zamora, Daniel. »When Exclusion Replaces Exploitation.« <http://nonsite.org/feature/when-exclusion-replaces-exploitation>.
[18] C.f. Gunn, Richard. »Notes on ‘Class’«. <http://www.richard-gunn.com/pdf/4_notes_on_class.pdf>.
[19] Aufgrund der Gleichzeitigkeit von Abstraktem und Konkretem, wird im Folgenden statt von “Überschussbevölkerung” von “Surplus-Proletariat” die Rede sein. Wie Marx in der Einleitung zu den Grundrissen bemerkt, ist die Kategorie der “Bevölkerung” – die Gesellschaft als zahlenmäßige Ansammlung von atomisierten Individuen voraussetzt – selbst eine “chaotische” Abstraktion vom Klassenverhältnis. “Bevölkerung” ist daher eine verquaste Subjektivierung eines Konzepts, das der vorliegende Text als ein dynamisches gesellschaftliches Verhältnis darzustellen sucht und nicht als eine Ansammlung von Identitäten. Marx selbst bringt die Kategorie der “Surplus-Population”/”Übervölkerung” in seiner Polemik gegen Malthus aufs Tapet und als ein Argument gegen Überbevölkerung als eine biologische Notwendigkeit. In dem Zusammenhang richtet Marx den Blick auf die historischen und gesellschaftlichen Bestimmungen des Phänomens der Überbevölkerung Marx Verwendung des Begriffs kann als ein Détournement der Terminologie Malthus‘ angesehen werden, d.h. als eine polemische Aneignung der Malthusianianischen Kategorien der klassischen Politischen Ökonomie, indem er sie vom Kopf auf die Füße stellt. Aus diesem Grund ist bei Marx auch von relativer und nicht von absoluter Surplus-Population die Rede. Es ist fraglich, ob heute noch die Notwendigkeit besteht, sich mit Malthus Ideologie der Überbevölkerung auseinander zu setzen. Eine lohnende Untersuchung wäre es allerdings, insofern im soziologischen Diskurs immer noch malthusianische Argumentationsmuster auftauchen, die effektiv die historisch-spezifische Rolle der Arbeitsproduktivität bei der Entstehung der Surplusbevölkerung vernebeln. Ein aktuelleres Beispiel wäre der Öko-Populismus anläßlich von Naturkatastrophen und sein Beharren auf Konsumverhalten und demographischen Problemen, statt sich mit der reelen Subsumtion der Natur unter die Formbestimmungen des Werts auseinanderzusetzen.
[20] Davis, Mike. Planet of Slums. 2006.
[21] Die folgenden Beiträge zeugen von der Gewalt, mit der sich die oben beschriebene Dynamik durchsetzt »Young people ‚feel they have nothing to live for’« <http://www.bbc.com/news/education-25559089>. »Spanish Suicides Rise To Eight-Year High«. <http://www.zerohedge.com/news/2014-02-03/spanish-suicides-rise-eight-year-high>. »Is Work Killing You? In China, Workers Die at Their Desks«. http://investmentwatchblog.com/is-work-killing-you-in-china-workers-die-at-their-desks/. »The Greek Mental-Health Crisis: As Economy Implodes, Depression and Suicide Rates Soar«. <http://content.time.com/time/world/article/0,8599,2079813,00.html>. »Suicide rates increased with global economic crisis«. <http://www.medicalnewstoday.com/articles/266181.php>. »US suicide rate rose sharply among middle-aged«. <http://bigstory.ap.org/article/us-suicide-rate-rose-sharply-among-middle-aged>. »Banker Suicides Return«. <http://www.zerohedge.com/news/2014-10-24/banker-suicides-return-dsks-hedge-fund-partner-jumps-23rd-floor-apartment>.
[22] Wie Rocamadur von der Gruppe Blaumachen schreibt: »Die gefährlichen Klassen des 21. Jahrhunderts entsprechen nicht dem traditionellen Lumpenproletariat [19], welches am äußersten Rand der proletarischen Reservearmee in seiner eigenen Welt lebte und von Anfang an vom zentralen Kapitalverhältnis ausgeschlossen war. Das neue „Lumpenproletariat» (die neuen gefährlichen Klassen) durchdringt deshalb die normalen Arbeitsverhältnisse, weil das „normale» Proletariat lumpenproletarisiert wird. Durch den Druck gestiegener Arbeitslosigkeit, geringfügiger Beschäftigung und Schulden (…) und des eingeschränkten Zugangs zu Kredit kommt es zur plötzlichen Verarmung zahlreicher Arbeiter (wie es in der gesamten westlichen Welt der Fall ist). Erst recht erzeugt sie eine weitere Lumpenproletarisierung des Proletariats selbst – eine Lumpenproletarisierung, die nicht in einem äußeren Verhältnis zur Lohnarbeit steht, sondern ein ihr inhärentes Moment ist..« (The feral underclass hits the street in: Sic!, Heft 2, 2014 )
[23] Wieweit diese These zutrifft, ist eine offene Frage, die weiter diskutiert werden müsste. Jedoch sind einige vorläufige Bemerkungen angebracht: (1) Mit Blick auf Geschlecht lässt sich sagen, dass das Surplus-Proletariat insgesamt seinem Wesen nach feminin ist, insofern »die allgemeine Tendenz zur ‚Feminisierung‘ keine geschlechtliche Formierung eines geschlechtsblinden Marktes ist, sondern den Drang des Kapitals ausdrückt, unter postfordistischen, globalisierten Bedingungen eine billige, befristet angeheuerte und flexibilisierte Arbeitskraft einzusetzen, die zunehmend entqualifiziert ist und auf Abruf bereit steht.« (The Logic of Gender, in: Endnotes 3 (2013)). Die Produktion des Surplus-Proletariats bedeutet insofern eine Feminisierung des Proletariats an sich. Zu untersuchen wäre in diesem Sinne, wie die gegenwärtigen Entwicklungen seit der Krise die Reproduktion reprivatisiert und traditionelle Rollen in der Familie aktualisiert haben. (2) Auch Ethnisierungsprozesse innerhalb des Surplus-Proletariats lassen sich als Ausdruck der antagonistischen Verhältnissen begreifen. Seine Existenz führt der Arbeitskraft höhnisch die Grenzen ihrer Verkäuflichkeit vor Augen; ihr Gebrauchswert für das Kapital wird nicht realisiert; sie wird zu einer leeren Materialität, die sich an die gesellschaftliche Gültigkeit der Tauschbeziehung klammert, aber letztlich auf die Naturalisierung äußerlicher Unterschiede zurückgreift. Zudem sind Arbeitsmigranten konstitutiv für informelle Arbeitsmärkte und insofern notwendige Personifikationen der allgemeinen Entwertung von Arbeitskraft. Die Ethnisierung von Arbeitskraft betrifft somit nicht nur ein bestimmtes Segment des Proletariats, sondern resultiert aus der Dynamik des Surplus-Proletariats, die sich durch ethnische, nationale und phänotypische Zuschreibungen ausdrückt. Vgl. R.L. »Inextinguishable Fire: Ferguson and Beyond« und »Burning and/or Demanding. On the Riots in Sweden«, in: Sic 3 (im Erscheinen). (3) Wie das Wesen des Surplus-Proletariats in Spannungen zwischen Generationen [? – generational disparity] erscheint, erörtern ebenfalls R.L. »Inextinguishable Fire« und »’Old People are Not Revolutionaries!‘ Labor Struggles Between Precarity and Istiqrar in a Factory Occupation in Egypt«, < http://www.focaalblog.com/2014/11/14/dina-makram-ebeid-labor-struggles-and-the-politics-of-value-and-stability-in-a-factory-occupation-in-egypt/>. Marx’ Beschreibung einer flüssigen Überschussbevölkerung nimmt besonders den Alterungsprozess von Arbeitskraft in den Blick. Zu seiner Zeit waren Arbeiter ab einem bestimmten Alter körperlich nicht mehr in der Lage, den Anforderungen des Produktionsprozesses nachzukommen. Heute hat sich die Situation deutlich gewandelt, insofern das Kapital in einem ausufernden Dienstleistungssektor, besonders in Fast-Food-Restaurants, auch die Älteren in niedrig bezahlten Teilzeitjobs unterbringt. Vgl. »Low-Wage Workers Are Older Than You Think«. <http://www.epi.org/publication/wage-workers-older-88-percent-workers-benefit>; »In Tough Economy, Fast Food Workers Grow Old«, <http://www.nbcnews.com/feature/in-plain-sight/tough-economy-fast-food-workers-grow-old-v17719586>.
[24] Die steigenden Sozialausgaben und ihr Gebrauch durch Proletarier, die so Einkommen und Löhne zu entkoppeln suchten, war eine weitere Manifestation des damaligen proletarischen Aufbegehrens.
[25] Robert Kurz, »Doppelte Entwertung«, in: Neues Deutschland, 5.3.2012, <http://www.exit-online.org/textanz1.php?tabelle=aktuelles&index=3&posnr=551>.
[26] Zum Zusammenhang zwischen Währungsabwertungen und den Migrationsbewegungen des Surplus-Proletariats im ehemaligen Ostblock, vgl. »Russian Rouble Crisis Poses Threat to Nine Countries Relying on Remittances«. <http://www.theguardian.com/world/2015/jan/18/russia-rouble-threat-nine-countries-remittances>.
[27] Ein besonders eindrückliches Beispiel dafür ist die Unternehmerpropaganda für eine Kopplung von Löhnen an die Profite unter der Rubrik der Bekämpfung von Ungleichheit. C.f. »Fiat Chrysler CEO Takes Aim at Two-Tier Wages for UAW Workers«. <http://www.wsj.com/articles/fiat-chrysler-ceo-takes-aim-at-two-tier-wages-for-uaw-workers-1421080693>. »Fiat Chrysler Sets Bonus Scheme for Italian Workers«. <http://www.thelocal.it/20150417/fiat-chrysler-sets-bonus-scheme-for-italian-workers>.
[28] Diese Frage erörtern mit Blick auf die historische Überholtheit der Form der Arbeiterpartei Aaron Benanav/Joshua Clover, »Can Dialectics Break BRICS?«, South Atlantic Quarterly (2014),http://krieger.jhu.edu/arrighi/wp-content/uploads/sites/29/2014/03/Can-Dialectics-Break-BRICS_JHU.pdf.
[29] World Bank. »Labor force participation rate, total (% of total population ages 15+) (modeled ILO estimate)«, <http://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.CACT.ZS/countries/CN?display=default>.
[30] Endnotes, »Elend und Schulden«, Kosmoprolet 4 (2015), S. 81
[31] Einen guten Überblick über die Ursprünge des heutigen latenten Surplus-Proletariats in China bietet »Land Grabs in Contemporary China«, <http://libcom.org/blog/china-land-grabs>.
[32] Zu bedenken ist auch, dass die globale Arbeitsteilung oder Segmentierung der Kapitalakkumulation naturgemäß auch die Dynamik von Kapital und Arbeit in einzelnen Ländern verändert. China spielte lange Zeit die Rolle eines Landes mit niedriger organischer Zusammensetzung und großen arbeitsintensiven Industrien. Wenngleich sich dies zurzeit ändert, bedeutete seine Industrialisierung der letzten Dekaden die Produktion eines Surplus-Proletariats im Rest der Welt. In den einschlägigen Erzählungen über die Weltwirtschaft der 2000er Jahre wurde beständig über eine Kapitalflucht geklagt, durch die Industriearbeitsplätze gen Osten, in Regionen mit einer stärkeren Entwertung von Arbeitskraft verlagert wurden. Im Ergebnis führte dies zu einer Abwertung industrieller Arbeitskraft in Westeuropa und den Vereinigten Staaten. Insofern bedeutet die Proletarisierung der chinesischen Bevölkerung – die zugleich die Produktion eines Surplus-Proletariats im eigenen Land ist – auch die Erzeugung von Überbevölkerung in anderen Teilen der Welt.
[33] Im Austausch für das immense Produktivitätswachstum und die Verbilligung von Waren, die aus der kriegsbedingten massiven Kapitalentwertung resultierte, bescherte diese historische Periode dem Proletariat eine größere Kaufkraft und somit stärkere Integration in die Konsumsphäre. Wenngleich der Wert der Ware Arbeitskraft relativ zum produzierten Gesamtwert sank, konnte der Reallohn absolut steigen. Diese Tendenz ging zudem mit direkten Subventionen der Produktion und einem Anstieg des indirekten Lohns des Proletariats einher, das so den Luxus erlebte, für seine Arbeitskraft einen Preis geringfügig über dem absoluten Reproduktionsminimum zu erzielen. Mit indirekten Löhnen sind staatliche Ausgaben wie Sozialleistungen und Renten gemeint, die darauf abzielen, die Reproduktion der Arbeitskraft im gesamtgesellschaftlichen Maßstab abzusichern.
[34] Aufschlussreiche Reflexionen über die Aussichten von Syriza in Griechenland bietet Cognord, »Is it Possible to Win the War After Losing All the Battles?«, <http://www.brooklynrail.org/2015/02/field-notes/is-it-possible-to-win-the-war-after-losing-all-the-battles>.
[35] Das jüngste Beispiel dafür in Spanien schildert »Spanish government prepares new National Security Law«, <https://www.wsws.org/en/articles/2015/02/11/spai-f11.html>.
[36] Das Los von Proletariern, die sich als Mittelschicht begreifen, besteht in der ständigen Angst, für den Ausbeutungsprozess überflüssig zu werden. Dies wird als ein politisches Problem dargestellt, oftmals unter der Rubrik einer globalen Bürgerschaft. Die Bewegung der Platzbesetzungen von 2011, die durch Probleme der Stadtentwicklung, der öffentlichen Infrastruktur und durch Repression ausgelöst wurde, hatte darin eine zentrale Dynamik. Einerseits verliert der Staat seine Integrationskraft, andererseits wird in den sozialen Bewegungen die Notwendigkeit einer neuen Form politischer Vermittlung formuliert. Generell kann gesagt werden, dass sich die Welle von Kämpfen von 2008 bis 2012 durch eine Konfrontation mit dem Staat als primärem Gegner auszeichnete.
[37] Auch deshalb sollte Marx‘ gelegentliche Sorge über den reaktionären Charakter des sogenannten Lumpenproletariats überprüft werden.
[38] Natürlich existiert auch ein Verständnis des Proletariats als seinem Wesen nach immer schon fragmentiert. Es bezieht sich auf die allgemeine Lage einer Trennung von den Mitteln der Produktion und Reproduktion sowie auf die diversen wertförmigen Vermittlungen, die die Tätigkeit des Proletariats zu einer entfremdeten Macht über und gegen es machen. Aber so grundlegend solche Trennungen als Voraussetzungen des Tauschverhältnisses auch sein mögen, bieten sie uns wenig Aufschluss darüber, wie sich die Fragmentierung des Proletariats im heutigen Kapitalismus entwickelt.
[39] Das heißt selbstverständlich nicht, dass Kämpfe in der Produktionssphäre nicht mehr wichtig wären, sondern nur, dass sie in einem veränderten historischen und gesellschaftlichen Kontext der Klassenzusammensetzung eine andere Bedeutung annehmen. Sie lassen sich daher nicht als Wiederkehr der alten Arbeiterbewegung verstehen. Die wichtigere Frage lautet, ob solche Kämpfe ein Moment der Negation des Klassenverhältnisses in all seinen Vermittlungen aufweisen.